Das pentagonale Penrose-Muster, eine quasiperiodische Belegung der Ebene mit Fünfecken, spielt eine wichtige Rolle bei Quasikristallen (vgl. S. 32, Bild: A. Hauck).


Das pentagonale Penrose-Muster, eine quasiperiodische Belegung der Ebene mit Fünfecken, spielt eine wichtige Rolle bei Quasikristallen (vgl. S. 32, Bild: A. Hauck).
Was tun mit Yucca Mountain? - Ultraschnelles Datennetz - Zufriedene Doktoren - Green Card dank Studienabschluss?
Zu: „Rutherfords Erbe“ von Amand Faessler und Jochen Wambach, Oktober 2011, S. 35
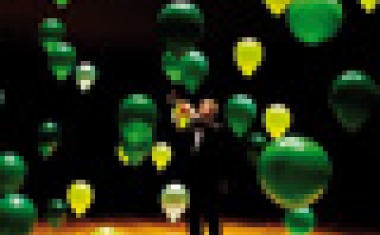 • 12/2011 • Seite 20
• 12/2011 • Seite 20Mit zwei Experimenten zur Anderson-Lokalisierung von ultrakalten Fermionen und Bosonen ist es in 3D-Laserspeckle erstmals gelungen, Materiewellen unterhalb der Mobilitätskante zu beobachten.
 • 12/2011 • Seite 22
• 12/2011 • Seite 22Mit zwei gegensätzlichen experimentellen Techniken wurde das Konzept der Ergodenhypothese minutiös getestet.
 • 12/2011 • Seite 27
• 12/2011 • Seite 27Für die Entdeckung der beschleunigten Expansion des Universums erhalten Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt und Adam G. Riess den Nobelpreis für Physik 2011.
Walter Baade und Fritz Zwicky, ein deutscher und ein schweizer Astrophysiker, die in Kalifornien forschten, prägten 1934 den Begriff „Supernova“ für gigantische Sternexplosionen. Diese erstrahlen so hell, dass sie über weite Bereiche des Universums zu beobachten sind. Baade und Zwicky identifizierten zwei Hauptgruppen von Supernovae – solche mit Wasserstofflinien in ihren Spektren (als Typ II bezeichnet) und solche ohne Wasserstoff (Typ I) – und schlugen bereits vor, dass sich mithilfe von Supernovae kosmologische Entfernungen bestimmen lassen.
Anfang der 1980er-Jahre griff vor allem Andreas Tamman diese Idee wieder auf und zeigte, dass sich dafür vor allem Supernovae vom Typ Ia eignen. Bei dieser wichtigen Unterkategorie handelt es sich um thermonukleare Explosionen von Weißen Zwergen, erloschenen Sternen mit etwa 1,4 Sonnenmassen, die kurzzeitig sogar eine ganze Galaxie überstrahlen können. Im Verlauf der Explosion ändert sich die Helligkeit der Supernovae natürlich sehr stark und innerhalb weniger Tage. Der Helligkeitsverlauf ist aber relativ homogen, sodass die Hoffnung bestand, dass sie immer dieselbe Leuchtkraft am Maximum ihrer Lichtkurve erreichen würden. Damit würden sich Entfernungen einfach aus der beobachteten Helligkeit ableiten. Diese Hoffnung zerschlug sich 1991 gründlich, als einige Typ-Ia-Supernovae mit sehr unterschiedlichen Leuchtkräften beobachtet wurden. Zwei Jahre später zeigte allerdings Mark Phillips, dass sich die Form der Lichtkurve eignet, um die Leuchtkraft zu normieren. Seitdem gelten Typ-Ia-Supernovae als beste kosmische „Zollstöcke“.
Zu dieser Zeit bestand die Hauptaufgabe der beobachtenden Kosmologie darin, den Wert der momentanen Expansionsrate des Universums und der Abbremsung aufgrund der Gravitationsanziehung der Materie zu bestimmen. Die Expansionsrate, also die Hubble-Konstante, muss im nahen Universum gemessen werden. Aufgrund der Abbremsung hat sich diese „Konstante“ als Funktion der Zeit verändert, man spricht daher vom Hubble-Parameter. In der Vergangenheit hatte er einen größeren Wert als heute. Diese Abbremsung lässt sich nur über große Distanzen messen. ...
 • 12/2011 • Seite 31
• 12/2011 • Seite 31Für die Entdeckung der Quasikristalle erhält Daniel Shechtman den Chemie-Nobelpreis 2011.
Traditionell teilen sich Festkörper in zwei Klassen auf: Kristalle und amorphe Phasen. Sie unterscheiden sich durch die Existenz (bzw. das Fehlen) einer atomaren Fernordnung. Seit den Arbeiten von René Just Haüy im 18. Jahrhundert ist bekannt, dass ein periodischer Aufbau die äußere Form von Kristallen erklären kann. Zur Beschreibung genügt eine von drei Vektoren aufgespannte Einheitszelle, die eindeutig mit Atomen belegt („dekoriert“) ist und sich nach den drei Raumrichtungen wiederholt, wie eine in die dritte Dimension erweiterte Tapete. Röntgenstrahlen oder Elektronen streuen an Kristallen um Wellenvektoren aus dem reziproken Gitter, das aus Summen und Differenzen einer Gitterbasis von drei Vektoren besteht.
In den 1970er-Jahren wurde heftig diskutiert, welche Abweichungen von periodischen Festkörperstrukturen möglich sind. Da gab es zunächst die inkommensurabel modulierten Kristalle, bei denen die Atome wie in einer eingefrorenen Schallwelle sinusförmig ausgelenkt sind. Die Wellenlänge der Modulation und die Gitterkonstante des Ausgangskristalls stehen in einem irrationalen Verhältnis, sodass es kein gemeinsames Vielfaches gibt und eine aperiodische Gesamtstruktur entsteht. Im reziproken Raum tritt zur Gitterbasis des Ausgangskristalls der Wellenvektor der Modulation hinzu, d. h. alle Reflexe sind jetzt Summen und Differenzen von vier Vektoren – ein als „quasiperiodisch“ bezeichneter Zustand. Indem der Modulationsvektor eine eigene Dimension erhielt, entstand ein vierdimensionaler periodischer Kristall, zunächst im reziproken, dann durch Fourier-Transformation im direkten Raum. Aus letzterem geht der inkommensurable Kristall durch Schnitt mit einer dreidimensionalen Hyperebene, dem physikalischen Raum, hervor. Dies war die Geburtsstunde der höherdimensionalen Kristallographie für aperiodische Systeme. ...
 • 12/2011 • Seite 35
• 12/2011 • Seite 35Mithilfe der Infrarot- und Raman-Spektroskopie lassen sich Marker für verschiedene Krankheiten im Blut bestimmen.
Chemische Methoden erlauben es, die Inhaltsstoffe des Blutes sehr genau zu bestimmen, und bilden daher eine unverzichtbare Säule der medizinischen Diagnostik. Da diese Methoden zum Teil recht aufwändig sind, versuchen Wissenschaftler nun, diagnoserelevante Informationen direkt aus dem Infrarot- oder Raman-Spektrum des Blutes abzuleiten. Erste Erfolge dieser reagensfreien Diagnostik bedürfen zwar noch der weiteren Überprüfung und Entwicklung, sie sind jedoch auf dem Weg zur Anwendung einen großen Schritt vorangekommen.
Blut ist ein ganz besonderer Saft – dies stand auch schon lange vor Goethes Faust außer Zweifel. Medizinisch gesehen besteht Blut aus zellulären Bestandteilen (Erythrozyten, Thrombozyten, Leukozyten) und einer Flüssigkeit, dem Plasma. Lässt man Blut stehen und zentrifugiert es anschließend, trennt es sich in einen Blutkuchen (Zellen, Fibrinogen, etc.) und eine gelblich-klare Flüssigkeit, das Serum. Wasser ist wiederum Hauptbestandteil des Serums, gefolgt von Eiweiß (Proteinen), Fett (Lipiden) und niedermolekularen Stoffen mit geringerer Konzentration. Zu letzteren gehört mit einer Konzentration von typischerweise 100 mg/dl die Glucose, der Blutzucker.
Die Konzentration der Blutbestandteile spielt häufig eine entscheidende Rolle für die Diagnostik. Beispielsweise diagnostiziert ein Arzt beim Auftreten einer Glucosekonzentration von mehr als 126 mg/dl (nach mindestens achtstündigem Fasten) Diabetes mellitus. Erhöhte Werte von Amylase und Lipase deuten auf eine entzündete Bauchspeicheldrüse hin, zu hohe Konzentrationen von Harnsäure im Blut geben einen Hinweis auf eine Nierenstörung ebenso wie erhöhte Werte für Kreatinin. Gerinnungsparameter, Hormonstatus oder Tumormarker sind ebenfalls von hoher medizinischer Relevanz. Diese Liste lässt sich lange fortsetzen. ...
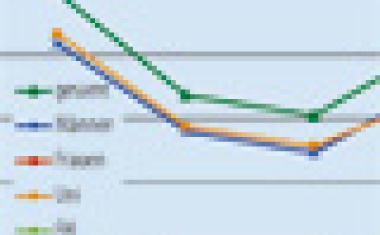 • 12/2011 • Seite 41
• 12/2011 • Seite 41Statistiken und Analysen für das Jahr 2011
Der Arbeitsmarkt für Physikerinnen und Physiker folgt der wirtschaftlichen Entwicklung und entspannt sich 2011 weiter. So ist erstmals seit 2008 die Anzahl der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Arbeitssuchenden gegenüber dem Vorjahr signifikant gesunken. Gleichzeitig ist die Zahl der Stellenmeldungen bei der Bundesagentur für Arbeit gegenüber dem Vorjahr wieder gestiegen. Nach wie vor scheinen junge Physiker und Physikerinnen eher von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein als berufserfahrene.
Stellenangebote
Die Zeichen für Physikerinnen und Physiker stehen gut: So wurden der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Berichtszeitraum etwa 21 Prozent mehr offene Stellen gemeldet [1, 2]. Damit ist das Vorkrisenniveau wieder erreicht.
Die meisten gemeldeten Stellenangebote kamen 2011 mit etwa 21,7 Prozent aus dem Bereich Forschung und Entwicklung (Tab. 1). Dagegen hat sich das Stellenangebot aus dem Hochschulbereich etwa halbiert. Dieser Wert ist der seit Beginn der Auswertung im Jahr 2006 geringste bislang ermittelte Wert!
Die Angebote aus dem produzierenden Gewerbe haben sich gegenüber 2010 versechsfacht und spiegeln die Fachkräftelücke in der Industrie wider. Den größten Anteil daran haben Optik und Gerätebau, wohingegen die Nachfrage in den Bereichen Elektronik und Bauelemente deutlich geringer gestiegen ist. ...
International WE-Heraeus Physics Summer School